

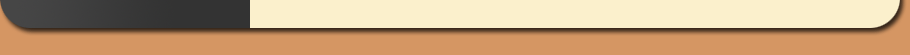

Über die Entwicklung der plattdeutschen Sprache
- eine Abhandlung von Franz - Josef Althoff -
Glücklich ist der zu schätzen, der neben unserer hochdeutschen Allgemeinsprache noch seine heimatliche Mundart spricht. Denn ihm steht in gewisser Hinsicht ein viel größerer Reichtum an sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung als dem, der nur in der oft so farblosen hochdeutschen Umgangssprache zu Hause ist.
Es ist nicht nur der altvertraute Klang der Muttersprache, der uns anheimelt, sooft wir ihr wieder begegnen, sondern auch die ganze Art sich auszudrücken, die Unmittelbarkeit, Anschaulichkeit und Treffsicherheit der Rede, die in der scharfen Beobachtungsgabe des einfachen, nicht vom Intellekt her geprägten Menschen wurzeln und den eigentümlich lebendigen, prägnanten und zugleich auch gemüthaften Stil volkstümlichen Sprechens erzeugen, den wir alle kennen und schätzen sollten.
Wir sind ja zum Glück hinaus über jene überhebliche und falsche Ansicht, dass die Mundart ein Hemmnis für die Geistesbildung sei, und denken mit Genugtuung an unseren größten Dichter, der sich gern seiner Frankfurter Mundart erinnere, in der er aufgewachsen war. „Jede Provinz liebt ihr Dialekt“, so schrieb er in „Dichtung und Wahrheit“, „denn er ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Atem schöpft.“ Goethe beklagt sich an jener Stelle auch über das damalige Schrifthochdeutsch, das sogenannte „Meißische“, das die Sprache der übrigen Landschaften nicht gelten lassen wollte. Und man weiß ja aus der Geschichte jener deutschen Jugendbewegung, die man „Sturm und Drang“ nennt, dass damals die junge Generation ganz bewusst zum mundartlich gefärbten Hochdeutsch zurückkehrte, eben weil in der Mundart die Seele lebt und weil Gefühl, Phantasie und Denkweise sich eigens darin aussprechen.
Der Anspruch der geregelten und regelgebenden Hochsprache, der sich in Goethes Jugend gerade erst in den obersten Schichten geltend machte, hat heute, 200 Jahre später, unser ganzes Volk erfasst und ist im Begriff, wenigstens in Norddeutschland, die gewachsenen Mundarten völlig zu ersetzen und schließlich zu vernichten. Das wäre bedauerlich, weil es eine Verarmung unseres Volkslebens bedeuten würde und zugleich einen Schritt zur Uniformierung und zur Vermassung. Kann man etwas dagegen tun?
Die Mundart künstlich am Leben erhalten zu wollen, wäre verlorene Liebesmühe. Aber ich meine, dass die Mundart auch heute, im Zeitalter der Technik und der Masse, durchaus lebenskräftig ist. Die süddeutschen Landschaften und die Schweiz liefern den Beweiß dafür. Dort bedient sich jedermann mit der größtem Selbstverständlichkeit der angeborenen Mundart. Warum könnte das in Norddeutschland nicht auch so sein? Das entscheidende ist die innere Einstellung des Menschen. Bei uns herrscht in weiten Kreisen die Vorstellung, das Niederdeutsche sei eine an sich minderwertige Sprache, eine Art von verdorbenem Hochdeutsch. Schon die allgemeine Bezeichnung „Plattdeutsch“ erweckt solche Gefühle: man denkt an eine platte, verdorbene Sprache. Aber nichts wäre verkehrter als das!
Wenn man im Plattdeutschen, z.B. nicht wie im Hochdeutschen, zwischen „mir“ und „mich“ unterscheidet, so ist das kein Zeichen von Verderbnis, sondern ein Beweiß der Andersartigkeit gegenüber dem Hochdeutschen. Wer Englisch oder Holländisch kann, weiß, dass in diesen Sprachen auch nicht zwischen „mir“ und „mich“ unterschieden wird, genau wie im plattdeutschen. Diese Andersartigkeit des Niederdeutschen ist der Grund dafür, dass es gegenüber dem Hochdeutschen einen so schweren Stand hat. Die Ober- und Mitteldeuteschen Mundarten haben es da leichter, sie sind ja der Mutterboden, aus dem die hochdeutsche Allgemeinsprache erwachsen ist. Gegenüber diesem engen Verwandtschaftsverhältnis zwischen der hochdeutschen Allgemeinsprache und den hochdeutschen Mundarten nimmt sich das Plattdeutsche fremd, wie ein entfernter Verwandter aus, dessen Verwandtschaftsgrad kaum noch erkennbar ist. Das Niederdeutsche ist eben von Haus aus eine eigene interessante Sprache, die in vielen Zügen dem Englischen und Niederländischen näher verwandt ist als dem Hochdeutschen. Und das Plattdeutsche hat auch eine eigene interessante Geschichte, die wir länger als 1000 Jahre hindurch verfolgen können. Davon soll im Folgenden einiges gesagt werden.
Das Niederdeutsche oder Plattdeutsche gehört mit dem Englischen, Friesischen und Holländischen zu der Familie der nordseegermanischen Sprachen, und die Familienähnlichkeit dieser Sprachen ist unverkennbar. Man denke nur an das männliche Fürwort, das im Hochdeutschen „er“ heißt. Das entsprechende plattdeutsche Wort gehört zu einem ganz anderen Wortstamm: es heißt bekanntlich „he“ oder „hei“; und dieser mit „h“ anlautende Stamm liegt auch im englischen Wort „he“ vor, ebenso im niederländischen „hij“. Man könnte noch eine ansehnliche Zahl weiterer Übereinstimmungen im Bau dieser nordseegermanischen Sprachen anführen, die noch heute Zeugnis ablegen von engen Verwandtschaften dieser Gruppe. Ihre Gemeinsamkeiten haben sich schon in den ersten Jahrhunderten nach Christus herausgebildet; sie müssen ja bereits bestanden haben, bevor die Angeln und Sachsen, die Vorfahren der heutigen Engländer, im 5. Jahrhundert von Norddeutschland aus die britischen Inseln besiedelten. Das lässt sich allerdings nur aus späteren Zeugnissen erschließen, da wir aus jener frühen Zeit noch nichts in diesen Sprachen Geschriebenes besitzen. Die eigentliche Geschichte des Angelsächsischen, d.h. also der Vorstufe unseres heutigen Plattdeutsch, ist uns erst seit der Zeit Karls des Großen fassbar.
In dem Jahrhundert vor dem Regierungsantritt Karls des Großen aber war die große grundlegende Veränderung zu Ende gegangen, durch die sich das Niederdeutsche vom Hochdeutschen getrennt hat. Eine Veränderung, die jedem aufmerksamen Betrachter bei einem Vergleich der beiden Sprachen nicht entgehen kann. Wem fielen die Unterschiede nicht auf, wie zwischen „water“ und „Wasser“, „loaten“ und „lassen“, „laupen“ und „laufen“, „chriepen“ und „greifen“, „söken“ und „suchen“, „Eecke“ und „Eiche“? Um uns diese Unterschiede genauer klarzumachen, müssen wir etwas weiter ausholen.
Es ist den meisten bekannt, dass sich infolge der großen germanischen Völkerwanderung im 4. und 5. Jahrhundert n. Chr. Die Wohngebiete der Germanen veränderten. Geschoben von den Hunnen, zogen einzelne Völkerstämme, wie die Goten und Vandalen, westwärts und südwärts, und es dauerte Jahrhunderte, bis die wandernden Germanen feste Wohnstätten wiedergewonnen hatten. Alles Land östlich der Elbe hatten sie verlassen, es war von den nachdrängenden Slawen besetzt worden. Nach der Völkerwanderung bildeten Trave, Elbe, Saale und Böhmerwald die Ostgrenze der germanischen Wohngebiete; Schlesien, Sachsen, Brandenburg, Preußen, Pommern, Mecklenburg, Ostholstein waren slawisch geworden.
Diese deutschen Landesteile sind erst später wieder erobert und für das Deutschtum zurückgewonnen worden. Das Stammgebiet der Deutschen aber wurde von fünf Hauptvolksstämmen bewohnt: den Sachsen im Norden, den Bayern und Alemannen im Süden und den Thüringern und Franken in der Mitte. Obgleich es eigentliche Sprachdenkmäler aus dieser Zeit nicht gibt, hat man aus dem späteren Sprachstand und den erhaltenen Eigennamen erkennen können, dass diese fünf Volksstämme bis zum 6. Jahrhundert n. Chr. Dieselbe Sprache redeten, dass also große mundartliche Gegensätze sich nicht herausgebildet hatten. Die norddeutschen Volkstämme waren auch in der Sprache ganz gleichartig mit den mittel- und ostdeutschen Stämmen. Die Einheitlichkeit in der Sprache der deutschen Völker ist erst im Laufe des 6. und 7. Jahrhunderts gestört worden.
Im 5. Jahrhundert begann im äußersten Süden des deutschen Sprachgebietes eine eigenartige Lautveränderung innerhalb des Konsonantenbestandes. Sie bildete sich auch im oberdeutschen Sprachgebiet auf alemannischem und bayrischem Boden, griff weiter um sich, drang allmählich nach Norden vor und eroberte auch die mitteldeutschen Gebiete. Nordwärts wurde aber die neue sprachliche Bewegung immer schwächer, und an der Grenze des Sachsenstammes fand sie ihr Ende. Der norddeutsche Stamm der Sachsen fügte sich nicht der sprachlichen Neuerung, er behielt den alten Lautstamm bei. Da also seine Sprache keine Veränderung erlitt, war Norddeutschland von nun an gegen Mittel- und Oberdeutschland zu der schon bestehenden Staatsgrenze auch noch durch eine scharfe Sprachgrenze getrennt und ganz Deutschland sprachlich in zwei große Gebiete gespalten. Um 700 n. Chr. Etwa muss die Lautveränderung beendet gewesen sein. In den ältesten hochdeutschen Sprachdenkmälern erscheint sie nämlich bereits als abgeschlossen.
Die Veränderung, die man die „hochdeutsche Lautverschiebung“ nennt, bestand darin, dass die Art der Hervorbringung bestimmter Konsonanten sich änderte. Besonders betroffen wurden die harten t-, p- und k- Laute und ihr Schicksal ist das eigentlich trennende gewesen. Bei einem Vergleich hoch- und plattdeutscher Sprachformen von heute ist es noch deutlich zu erkennen. Man hat dabei auf die Stellung dieser drei Laute im Wort zu achten und dabei zwei Fälle zu unterscheiden: erstens ihre Stellung im Anlaut, im Inlaut und Auslaut nach Konsonanten, zweitens auf ihre Stellung im Inlaut und Auslaut nach Vokalen.
„t“ wurde im ersten Fall zu „z“, im zweiten zu „zz“ (tz), „ss“, „ß“ verschoben. Es stehen sich also gegenüber:
niederdeutsch/ hochdeutsch:
1. Teken Zeichen
Tung Zunge
Tand Zahn
Twee zwei
Hiärt Herz
swatt schwarz
Holt Holz
2. sitten sitzen
Katt Katze
Iäten essen
bieten beißen
Woater Wasser
ut aus
natt naß
wat was
chraut groß
Bei den engen Konsonantenverbindungen „st, tr,ft,cht“ unterblieb die Verschiebung, weil die Vereinigung zu eng war, um zerrissen zu werden:
Strit Streit
Trü treu
u.s.w.
Für den Laut „p“, das zu „f“ bzw. „pf“, und „k“, die zu „ch“ verchoben wurde, stehen sich gegenüber:
chriepen greifen
supen saufen
uopen offen
Liäpel Löffel
Laupen laufen
Schipp Schiff
daip tief
up auf
riep reif
Koken Kuchen
maken machen
briäken brechen
ik ich
auk auch
chliek gleich
week weich
Diik Teich
Biek (i danach e sprechen) Bach
Das „p“ blieb unverschoben in der Vrbindung „SP“ (Spijl – Spiel)und ist in weiten hochdeutschen Gebieten (Süd- und Mittelfranken) im Anlaut zwar zu „pf“, im Inlaut und Auslaut nach Konsonanten aber oft über „pf“ zu „f“ weiterverschoben worden. So stehen sich gegenüber:
Piärd Pferd
Piep Pfeife
Ploch Pflug
Pann Pfanne
schimpen schimpfen
stump stumpf
stampen stampfen
aber:
helpen helfen
Duorp Dorf
Scharp scharf
Unverschoben bleiben „t,p,k“ natürlich auch in Lehn- und Fremdwörtern, die erst nach der Lautverschiebung ins Hochdeutsche eindrangen (Priester, Paradies, Pilger, predigen), während vorher eingedrungene Wörter die Verwandlung mit durchmachen mussten. So z.B.:
lateinisch niederdeutsch hochdeutsch
tegula Tegel (Steen) Ziegel
planta Plant Pfanze
(prunus) persica Päschken Pfirsich
Die Lehnwörter bilden daher ein Mittel, die Zeitfolge der Verschiebung von „t,p und k zu bestimmen, wenn z.B. lateinisch „porta“, niederdeutsch „Poat“ zu hochdeutsch „Pforte“ verschoben wurde. Ein Vergleich zwischen lat. „picem“, nd. „pink“ und hd. „Pech“ lehrte, daß die Verschiebung des „p“ bereits beendet war, al die des „k“ zu „ch“ noch erfolgte. Die Lautverschiebung ist also nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich in der Reihenfolge „t,p,k“ Schritt für Schritt vorgedrungen.
Wir sehen, das Niederdeutsche hat ein älteres Gepräge als das Hochdeutsche, es ist auf dem Stand des Altgermanischen stehengeblieben, indem es die stimmlosen Verschlusslaute „t,p,k“ beibehielt. Der Vorgang der Lautverschiebung hat erst den Unterschied zwischen den ober- und mitteldeutschen und den niederdeutschen Mundarten hervorgerufen, und da die Wirkung der Verschiebung im Süden stärker waren und nach Norden hi sich allmählich verringerten, so grenzten sich auch nach dem verschiedenen Eingreifen der Lautveränderung die einzelnen mittel- und hochdeutschen Mundarten voneinander ab.
Wenn unser Vaterland noch heute sprachlich in ein hochdeutsches und in ein niederdeutsches Gebiet gespalten erscheint, so ist das die Folge der Lautveränderungen jener Zeit. Wo der alte Lautstand erhalten blieb, da ist Niederdeutschland, und die Grenzlinie, bis zu der Lautverschiebung damals vorgedrungen ist, bildet die Südgrenze des niederdeutschen Sprachgebietes. Diese sprachliche Grenzlinie ist von Dorf zu Dorf bestimmt worden und festgelegt in dem „Sprachatlas des deutschen Reiches“, begründet von dem Magdeburger Gelehrten Gustav Wenker (1876). Man hat sie die „Benrather Linie“ (s. Karte) genannt, weil sie bei Benrath den Rhein überschreitet.
Sie geht von Westen nach Osten mit einer leichten Neigung nach Nordosten quer durch Deutschland. Sie beginnt an der französischen Grenze in der Nähe von Limburg, zieht linksrheinisch nördlich an Aachen und Köln vorbei, rechtsrheinisch über Düsseldorf, Solingen, Remscheid, Waldeck, Naumburg, Kassel, Nordhausen, (Göttingen bleibt nördlich), am Südrande des Harzes entlang (Heiligenstadt, Sachsa, Harzgerode, Quedlinburg) und erreicht die Elbe einige Meilen südlich von Magdeburg. Sie begleitet dann den Lauf der Elbe aufwärts bis Wittenberg, welches hochdeutsch bleibt, verläuft weiter durch das südliche Brandenburg (Berlin bleibt nördlich) bis zur Oder oberhalb Frankfurts. Vor der Vertreibung der Deutschen jenseits der Oder-Neiße-Grenze verlief die Sprachgrenze über die Warthe bei Birnbaum und trennte dann das Niederdeutsche vom Slawischen. Diese Grenzlinie ist im Laufe der Jahrhunderte nur sehr wenig zu Gunsten des Hochdeutschen nach Norden vorgerückt.
Wer sich mehr für diese Dinge interessiert, dem sei der „DTV-Atlas zur deutschen Sprache“ empfohlen, der über Einschlägiges sehr breit informiert.
 | De Pättkeslüe |  |  | Denkmalpflege |  |  | Heimatkunde |  |  | Brauchtumspflege |  |  | Radfahren und Reisen |  |  | Senioren |  |